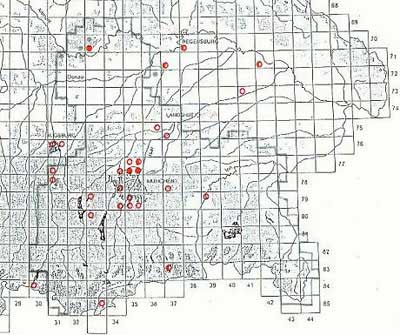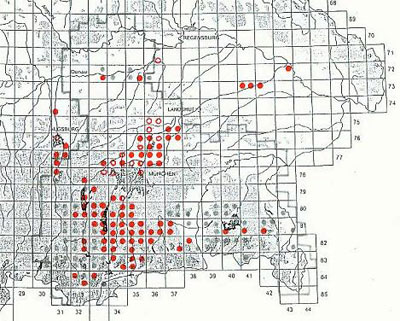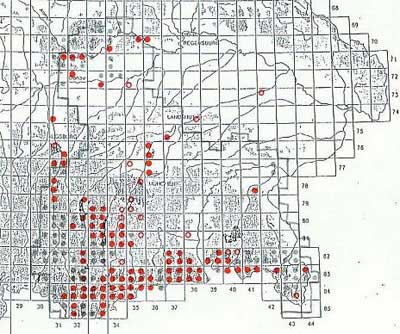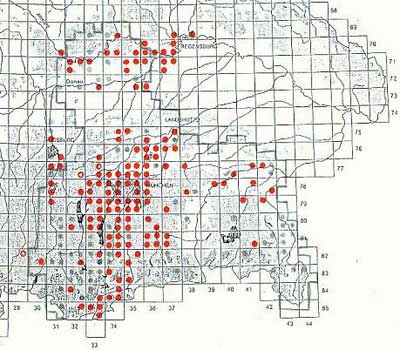Schachbrett (oben und unten)
Eching,
Mallertshofer Holz (FS), 29.06.2006

Schachbrett auf Knabenkraut, Männchen
Weilheimer Hardt (WM), 15.06.1998

Schachbrett, Männchen
Rohrenfeld, Donauauen (ND), 08.07.1994
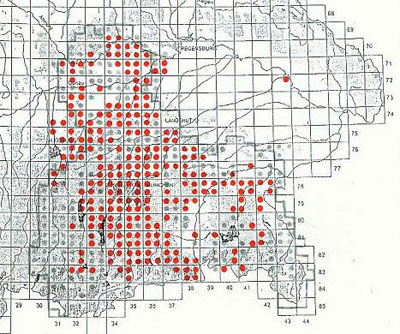
Verbreitung des Schachbretts in Oberbayern
(rot: eigene Beobachtungen)

Schachbrett an Mädesüß
Eching, Garchinger Heide (FS), 07.1985

Schachbrett-Paarung
Dollnstein, Sonnleite (EI), 08.07.1994

3 Schachbretter beim Blütenbesuch
Donautal bei Fridingen (Schwäbische Alb), 08.1984
Melanargia galathea
(Schachbrett)
In allen Naturräumen (außer Alpenraum) eine der häufigeren Tagfalterarten. Vielerorts jedoch, insbesondere im östlichen Oberbayern, infolge der heutigen intensiven Landwirtschaft
auffallend selten geworden und dementsprechend z.B. in folgenden
Regionen kaum noch zu finden: Donaumoos (ND), um Markt Indersdorf
(DAH), Dorfen (ED), Neumarkt-St. Veit (MÜ), Ampfing (MÜ),
Aßling (EBE), Rosenheim (RO), Wasserburg am Inn (RO), Palling (TS) und Peterskirchen (TS). Besiedelt
ein breites Spektrum höchstens extensiv genutzter Lebensräume. Regelmäßig
in großer Anzahl in lichten Wäldern und auf Heideflächen nördlich Münchens
sowie den Talflankenheiden der Fränkischen Alb. Im Alpenraum in den
niedrigeren Lagen, im Brauneckgebiet aber erstaunlicherweise auch noch zwischen 1500 und 1700m nachgewiesen. Flugzeit Mitte Juni bis Mitte August.
Des öfteren Raupenfunde abends in lichten Wäldern nördlich Münchens.
|
Flugzeit: |
07.06. (2003) |
- |
06.09. (1991) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
|
- |
1700 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
12 (-/17/7/12/1) |
|||||||||||||||

Schachbrett, Paarung
Oberschleißheim,
Berglwald (M-L), 02.07.2000

Schachbrett (Melanargia
galathea), bräunliche Raupe
Oberschleißheim, Berglwald (M-L), 14.05.2000

Schachbrett, grünliche Raupe
Oberschleißheim,
Berglwald (M-L), 12.05.1997

3 Rostbinden beim Blütenbesuch auf Silberdistel
Schluderns, Muntetschinig (Südtirol), 28.08.1999
Hipparchia semele
(Rostbinde)
In Oberbayern unmittelbar vom Aussterben bedroht !
Letzte Vorkommen in
Kalksteinbrüchen und auf stark beweideten Talflankenheiden im südlichen
Frankenjura (eigene Beobachtungen aus der Umgebung von Eichstätt) sowie
auf Heideflächen nördlich Münchens. Auf der Panzerwiese seit 1994
verschollen. Das 2005 durch eine Einzelbeobachtung aktuell bestätigte
Vorkommen auf der Fröttmaninger Heide steht aufgrund umfangreicher Auf-
und Nachforstungsmaßnahmen der Bundesforstverwaltung, Aufgabe der
militärischen Nutzung, Überbauungen durch Wohngebiete und
Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der neuen Arena unmittelbar vor dem Erlöschen.
Flugzeit im Juli und August.
Blütenbesuche an Thymian und Grauer Skabiose.
RL D: 3 RL By: 2 (T/S: 1, Av/A: 0)
|
Flugzeit: |
20.07. (1992) |
- |
28.08. (1995) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
|
- |
530 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
|
|||||||||||||||

Fröttmaninger Heide
(M)
Lichte Kiefernwälder und vegetationsarme Schotterfluren
sind der
Lebensraum der Rostbinde und des Zweibrütigen
Würfeldickkopffalters
(beide in Oberbayern vom Aussterben bedroht)
sowie zahlreicher weiterer
bedrohter Insektenarten.

Eichstätt, Steinbrüche (EI)
Eiablagestelle der Rostbinde

Rostbinde (Hipparchia semele),
abends an Kiefer
Fröttmaninger Heide (M), 03.08.1997

München-Freimann, Fröttmaninger Heide (M), 28.08.1995
Lichte Kiefernwälder, Schotterfluren und Kleingewässer bieten zahllosen
Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Hier kommen vor: an
Tagfalterarten u.a. Rostbinde, die Dickkopffalter Hesperia comma,
Thymelicus acteon, Pyrgus armoricanus, die Bläulinge Polyommatus
bellargus, P. coridon, P. agestis, an Heuschrecken Stenobothrus
lineatus, S. stigmaticus, Myrmeleotettix maculatus und Metrioptera
bicolor, an Libellen Orthetrum brunneum und Sympetrum
pedemontanum, an Amphibien Wechselkröte und Laubfrosch, an Vogelarten
u.a. Heidelerche und Schwarzkehlchen usw
An Pflanzenarten u.a. Deutscher und Fransen-Enzian,
Berggamander, Silberdistel, Ähriger Ehrenpreis, Graue Skabiose, Gekielter
Lauch und Deutscher Backenklee.
Ab 1997/1998 massive Aufforstungen durch die Bundesforstverwaltung
mit Ahorn- und anderen
Laubgehölzen.

Rostbinde (Hipparchia semele)
München-Hasenbergl, Panzerwiese
(M), 11.08.1994

Rostbinde
Schluderns (Südtirol), 28.08.1999

Berghexe
(Chazara briseis), Männchen
Eichstätt,
Steinbrüche (EI), 07.08.1993
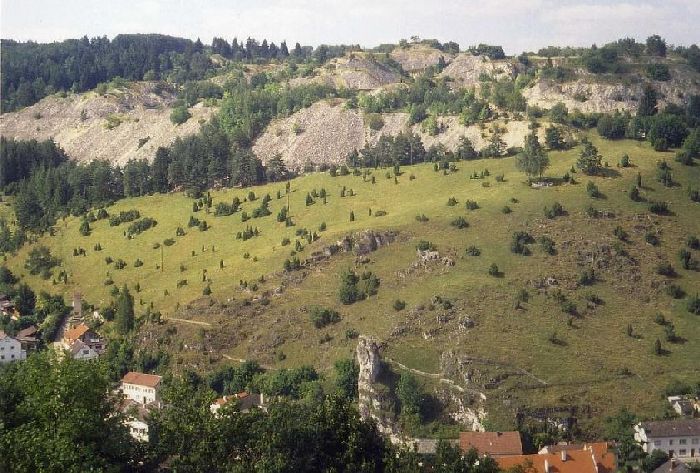
Ausgedehnte
Kalkmagerrasen und Steinbruchgelände im Gailachtal (EI),
Lebensraum von u.a. Berghexe, Apollo, Streifen- und Quendel-Bläuling.


4 Berghexen und 2 Rostbinden auf einer Silberdistel
Muntetschinig (Südtirol), 28.08.1999

Berghexe, Weibchen
Schluderns (Südtirol), 28.08.1999
Chazara briseis
(Berghexe)
Eine der seltensten Tagfalterarten Oberbayerns. Unmittelbar vom Aussterben bedroht.
Wenige Vorkommen im westlichen Frankenjura (Altmühltal mit Seitentäler).
Lebensraum sind (waren) stark beweidete Talflankenheiden mit ausgedehnten
Fels- und Geröllfluren. Aktuell wie der Apollo fast nur noch in
Kalksteinbrüchen. Ähnliche Ansprüche stellt die Rostbinde (Hipparchia
semele), unter den Heuschrecken die Rotflügelige Ödlandschrecke und
die Italienische Schönschrecke. Südlich der Donau auch früher (vor 1950) nur sehr lokal nachgewiesen,
dort ausgestorben.
Flugzeit im Hochsommer. Blütenbesuche u.a. an Stengellosen
Kratzdisteln.
RL D: 2 RL By: 1 (T/S und Av/A: 0)
|
Flugzeit: |
26.07. (1992) |
- |
11.08. (1990) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
|
- |
530 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
|
|||||||||||||||

Berghexe, Männchen
Eichstätt, Figurenfeld (EI), 10.08.1986

Gletscherfalter
(Oeneis glacialis)
Mittenwald, Hasellähne, 1100m (GAP), 09.06.1998
Oeneis glacialis
(Gletscherfalter)
Aktuelle eigene Beobachtungen aus dem
Wettersteingebirge und dem Karwendel. Im Raum Mittenwald - Scharnitz bis auf
1000m herabgehend. Im Rotwandgebiet aktuell nicht mehr gefunden. Fehlt
offenbar in den Berchtesgadener Alpen. Lebensraum sind geröllreiche, meist südseitige Hänge
und Felsfluren. Flugzeit relativ früh, bereits vorrangig im Juni kurz nach der
Schneeschmelze (ähnlich Pyrgus andromedae).
Blütenbesuch u.a. an Viola biflora. 2005 am Scheinbergjoch bei Linderhof und am
Krottenkopf nachgewiesen.
Eine gezielte Nachsuche
nach weiteren aktuellen Vorkommen wäre u.a. an folgenden Orten sehr
wünschenswert: Kramerspitz (8432/3), Schöttelkarspitze (8533/2), Benediktenwand
(8334/2) und Wendelstein (8238/3)
RL D: R RL By: R
|
Flugzeit: |
19.05. (2007), davor 09.06. (1998) |
- |
22.07. (2005) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
1000 |
- |
2050 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
|
|||||||||||||||

Geröllfluren bei der
Weilheimer Hütte auf knapp 2000m
Höhe (GAP),
unterhalb des Krottenkopfes, Lebensraum des Gletscherfalters

Hasellähne
bei Mittenwald (GAP)
Geröll- und Kalkfelsfluren (900-1200m) sind der Lebensraum
des
Gletscherfalters sowie u.a. Apollo, Styx-Mohrenfalter, Quendel-Bläuling,
Schwarzgefleckter Bläuling, Brauner Feuerfalter und Andromeda-Dickkopf. Unter den Heuschrecken ist Podisma pedestris besonders
erwähnenswert.

Oeneis glacialis
Ehrwald, Südseite Wettersteingebirge, etwa 1900m (Nordtirol),
19.05.2007

Oeneis glacialis, Männchen auf Gamskot
inmitten von Schneefeldern
Ehrwald, Südseite Wettersteingebirge, etwa 1900m (Nordtirol), 19.05.2007,
unten Ansitz auf einem Stein

Gletscherfalter
Karwendeltal (Nordtirol), 25.07.1999

Blaukernauge (Minois dryas), Paarung
Isarauen bei Fischerhäuser (M-L), 31.07.2006

Blaukernauge,
Weibchen beim Blütenbesuch an Wasserdost
Taubenberg, Steinbachtal
(MB), 06.08.1998

Blaukernauge, Männchen
Winden, Zigeunerhöhle (Burgenland), 12.08.1997

Blaukernauge (Minois dryas), Raupe
Kirchseemoor bei Stubenbach (MB), 01.06.2000

Ergertshauser Moor (TÖL), Lebensraum vom Blaukernauge
im Alpenvorland

Blaukernauge, Weibchen
Eschenrieder Moos (DAH), 05.08.1998
3ha großer Pfeifengraswiesenrest des einst riesigen Dachauer Mooses
heute inmitten des mehrere Hundert Hektar kleinen Golfplatzes

Pfeifengraswiesen und Birkenwälder im Fußbergmoos
(FFB), Oktober 1998
Lebensraum vom Blaukernauge. Weiterhin kommen hier u.a. vor:
Randring-Perlmuttfalter, Baldrian-Scheckenfalter, die Ameisenbläulinge
Maculinea nausithous und Maculinea teleius, Brauner
Feuerfalter und
das Widderchen Adscita statices.
Pflege durch den Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe
Fürstenfeldbruck, mit Mahd und Entbuschung, seit kurzem auch durch (bisher bezüglich
Artenschutz teilweise stark kontraproduktive) Beweidung.

Blaukernauge, Weibchen
Donauauen bei Neuburg (ND), 14.08.2002
Minois dryas (Blaukernauge)
Schwerpunkt im voralpinen Hügel- und
Moorland, zwischen Lech und Mangfall noch ziemlich häufig und
charakteristisch für Streuwiesen in Niedermoorgebieten und auf
Flussschotterheiden in den Auen. Fehlt im Alpenraum nahezu vollständig.
Auf den Schotterplatten nur noch wenige, isolierte Vorkommen, auch im
Unterbayerischen Hügelland aktuell nur noch lokal auf Brennenstandorten
in den Donauauen. Beispielhaft für den Rückgang im Naturraum
Münchener Ebene das Vorkommen im hoffnungslos durch die Landwirtschaft
und die Jagd eutrophierten Naturschutzgebiet (???) Oberdingermoos (ED), wo man in den
vergangenen Jahren den letzten bemitleidenswerten Faltern beim Aussterben
zuschauen konnte.
Obere Höhengrenze bereits bei etwa 800m. Das
Blaukernauge fliegt im Juli und August. Raupenfunde an Pfeifengras vom
23.05.1994, 12.06.1997 und 01.06.2000. Eifriger Blütenbesucher, oft in
Anzahl auf Wasserdost, des weiteren u.a. Heilziest, Dost, Blutweiderich, Färberscharte,
Teufelsabbiss, Kohl-Kratzdistel und Silberdistel.
RL D: 2 RL By: 2 (Av/A: 3)
|
Flugzeit: |
06.07. (2003) |
- |
10.09. (1995) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
|
- |
800 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
54 (-/26/-/-/-) |
|||||||||||||||

Blaukernauge (2x oben Weibchen, unten
Männchen)
und Großes Ochsenauge beim Blütenbesuch an Färberscharte
Erling-Andechs,
Mesnerbichel (STA), 05.08.1992

Durch Rotwildfütterung (Kartoffeln, Rüben, Mais-Silage)
eutrophierte ehemalige Pfeifengras-Streuwiesen im Naturschutzgebiet
Oberdingermoos (ED).
Hier stirbt gerade das Blaukernauge aus ! ! Bereits ausgestorben:
Sämtliche weiteren moortypischen Tagfalterarten. Dafür: massenhafte
Ausbreitung von Kanadischer Goldrute, Riesenbärenklau, Brennesseln,
Taubnesseln, Holunder; deutliche Zunahme von Tagpfauenauge, Admiral und
Landkärtchen als Alarmsignal: dieses Gebiet ist völlig kaputt ! Sehr
anschauliches und überaus sehenswertes Beispiel für die Zerstörung der
letzten Moorreste im Naturraum Münchener Ebene (gleiches gilt für
das Naturschutzgebiet Notzingermoos, ebenfalls ED).
NSG = Naturschmutzgebiet oder Notstandsgebiet ???

Weißer Waldportier
Hundsheimer Berg (Niederösterreich), 25.06.1992
Brintesia circe (Weißer Waldportier)
Aktuelle Vorkommen im südlichen
Frankenjura. Eigene Nachweise aus der Umgebung von Mörnsheim. Besiedelt
dort hochgrasige Magerrasen, zumeist in Waldnähe. Flugzeit Juli und August.
Südlich der Donau keine eigenen Beobachtungen, einige Nachweise aus dem 20.
Jahrhundert, zuletzt um 1988 bei Burghausen an der Salzach (Sage 1996).
RL D: 2 RL By: 2 (T/S: 1, Av/A: -)

Brintesia circe
Hohenburg (Oberpfalz), 21.08.1994

Raupe des Weißen Waldportiers
Abruzzen (Italien), Juni 1993

Weißer Waldportier
Jois, Martalwald (Burgenland), 30.08.1996

Milchfleck-Mohrenfalter
Kissinger Heide (Schwaben), 17.06.1989

Erebia ligea
Karwendeltal (Nordtirol), 25.07.1999
Erebia
ligea (Milchfleck-Mohrenfalter)
Zählt im Alpenraum zu den häufigsten
Tagfalterarten. Im Alpenvorland v.a. in waldreichen, höhergelegenen
("montan getönten") Gebieten, oft gemeinsam mit dem Natterwurz-Perlmuttfalter und dem Graubindigen Mohrenfalter. Aktuelle nördliche
Vorposten bei Fürstenfeldbruck, Andechs, Isartal bei Grünwald, Dietramszell und Holzkirchen. Lokal
offenbar auch im Fränkischen Jura. Erscheint Ende Juni / Anfang Juli, Flugzeit im Alpenraum bis Ende August.. Blütenbesuche an
Wald-Witwenblume, Flockenblumen und Kratzdisteln.
RL D: V RL By: V (T/S: 3, Av/A: n)
Ähnliche Art: Erebia euryale. Unterschiede: Augenflecke in der orangen
Randbinde oberseits bei E. euryale ohne weißen Kern; E. ligea unterseits mit Milchfleck; E.
euryale-Weibchen haben auf der Hinterflügel-Unterseite ein deutliches
weißliches Band.
|
Flugzeit: |
22.06. (2000) |
- |
29.08. (2000) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
547 |
- |
1753 |
|||||||||||||
|
Verbreitung:
|
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
52 (10/-/-/-/-) |
|||||||||||||||

Verbreitung von Erebia ligea in Oberbayern
(rot: eigene Beobachtungen)

Bergwald-Mohrenfalter, Weibchen
Ettal, Ochsensitz, 1500m (GAP), 05.08.2003
Erebia
euryale (Bergwald-Mohrenfalter)
Im Alpenraum häufig. Typische Art der
Bergwälder zwischen 1200 und 1500m, oft in großer Anzahl. Flugzeit Juli
/ August. Saugt gerne an Disteln und Witwenblumen.
Zweijährige Larvalentwicklung, im oberbayerischen Gebirgsraum in den ungeraden Jahren häufiger,
2005 war wieder ein gutes Flugjahr.
RL D: V RL By: V (Av/A: n)
|
Flugzeit: |
24.06. (2007), davor 29.06. (2003) |
- |
15.08. (1997) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
780 |
- |
1800 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
76 (32/-/-/-/-) |
|||||||||||||||

Erebia euryale, Weibchen
Mittenwald,
Wechselboden (GAP), etwa 1600m, 26.07.1994

Bergwald-Mohrenfalter
(Erebia euryale)
Benediktenwand,
Tanner-Alm (TÖL), 13.07.1997

Erebia euryale, Männchen
Linderhof, Sägertal, etwa 1100m (GAP), 24.06.2007

Erebia eriphyle
Ausschließlich in den Berchtesgadener
Alpen, dort auch aktuell durch Alfred Haslberger nachgewiesen. Keine eigenen Beobachtungen.
RL D: R RL By: R
Ähnliche Art: Erebia manto. Diese ist etwas größer; weibliche Tiere von
Erebia manto haben auf der Unterseite der Hinterflügel gelbliche Flecke

Weibchen des Gelbgefleckten Mohrenfalters
Mittenwald, Wechselboden, 1600m (GAP), 26.07.1994
Erebia
manto (Gelbgefleckter Mohrenfalter)
Lokale Vorkommen im Alpenraum in der
subalpinen Stufe. Eigenbeobachtungen aus dem Wetterstein- und dem Karwendelgebirge, den Chiemgauer Alpen (Geigelstein) und den
Berchtesgadener Alpen (u.a. Jenner). Besiedelt alpine
Rasen, Flachmoore und Rinderweiden. Flugzeit im Juli und August. Eine
Eiablagebeobachtung in die Blütenköpfe von Rotklee (25.07.1994). Blütenbesuche
an gelben Korbblütlern, Disteln und Tauben-Skabiose.
RL D: R RL By: R
|
Flugzeit: |
25.07. (1994) |
- |
30.08. (2005) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
1300 |
- |
1813 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
|
|||||||||||||||

Geigelstein, Gipfel
1800m (TS), August 1998
Lebensraum zahlreicher montan und
subalpin verbreiteter Tagfalterarten,
darunter die Mohrenfalter Erebia manto und Erebia pronoe, der Perlmuttfalter
Boloria pales sowie der Wundklee-Bläuling.

Wechselboden (GAP), Juli 1994

Gelbgefleckter
Mohrenfalter (Erebia manto), Männchen
Mittenwald, Wechselboden, 1600m (GAP), 26.07.1994 (oben und unten)

Mittenwald, Oberes
Dammkar, 2300m (GAP), Juli 1994
Alpine Rasen mit u.a. Schnee-Enzian (Gentiana nivalis),
Alpen-Leinkraut (Linaria alpina), Alpen-Spitzkiel (Oxytropis
jacquinii)
Lebensraum der Mohrenfalter Erebia epiphron, Erebia gorge und Erebia
pandrose, des Bläulings Polyommatus orbitulus und des Alpen-Gelblings

Schneibstein
(BGL), August 2005: Hier kommen u.a. Boloria
pales,
Erebia manto, Erebia epiphron und Erebia gorge vor

Erebia epiphron
Westliche Karwendelspitze (GAP), 2300m, 09.08.1994
Erebia epiphron
In den Hochlagen der Alpen. Eigene
Beobachtungen aus dem Karwendel (2000-2400m) und den Berchtesgadener Alpen
(u.a. Schneibstein) von alpinen Matten und Geröllrändern.
Die Falter fliegen im Juli /August und saugen u.a. an gelben Korbblütlern.
RL D: R RL By: R
Ähnliche Art: Erebia gorge, diese ist etwas größer und auf der
Hinterflügelunterseite anders gezeichnet, insbesondere das Weibchen.
|
Flugzeit: |
20.07. (2002) |
- |
30.08. (2005) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
2000 |
- |
2384 |
|||||||||||||
|
Verbreitung:
|
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
|
|||||||||||||||

Unpunktierter
Mohrenfalter
Mittenwald, Wechselboden, 1600m (GAP), 26.07.1994
Erebia
pharte (Unpunktierter Mohrenfalter)
Lokale Vorkommen im Alpenraum in der
subalpinen Stufe. Eigenbeobachtungen aus dem Ammer-, Wetterstein-, Karwendel
und dem Mangfallgebirge (Brecherspitz, Rotwandgebiet, Schinder) ab 1400m
(z.B. Obere Firstalm und Wiesbauern-Hochleger). Besiedelt hochwüchsige,
alpine Rasen (Rostseggenrasen), Rinderweiden und Flachmoore, oft gemeinsam
mit Erebia manto. Flugzeit ist v.a. der Juli. Blütenbesuche beobachtet an
Disteln, Knautien und Alpen-Kreuzkraut.
RL D: R RL By: R
|
Flugzeit: |
19.06. (2007), davor 30.06. (1998) |
- |
09.08. (1994) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
1262 |
- |
2050 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
100 |
|||||||||||||||

Alpine Rasen am Scheinbergjoch (etwa 1750m)
in den Ammergauer Alpen (GAP), Juli 2005
Hier kommen die Mohrenfalter Erebia pharte, gorge und oeme
vor,
des weiteren Gletscherfalter, Coenonympha gardetta und
Plebeius glandon

Karwendel, Wechselboden, 1600m (GAP), 26.07.1994
im Hintergrund die Soiernspitze
Die nordseitigen Rostseggenrasen bieten den Mohrenfaltern
Erebia manto, Erebia pharte und Erebia euryale geeigneten
Lebensraum

Erebia pharte
Rotwand, etwa 1700m (MB), 19.06.2007

Erebia pharte
Rotwand, Kümpfl-Alm, etwa 1600m (MB), 19.06.2007
Erebia melampus (Kleiner Mohrenfalter)
Osthelder (1925) nennt als Fundort die Brunnensteinspitze bei Mittenwald. Insofern streift Erebia melampus gerade noch Oberbayern. Keine aktuellen Nachweise.
RL D: R RL By R

Erebia melampus
Taschachtal (Tirol), 25.07.2006

Graubindiger
Mohrenfalter
Eching, Dietersheimer Brenne (FS), 02.08.1992

Mohrenfalter am Älpelesattel
in den Allgäuer Alpen (Schwaben), 10.08.1991
Erebia aethiops
Friedergries (GAP), 01.09.2006
Erebia
aethiops (Graubindiger Mohrenfalter)
Im Alpenraum häufig, von den Tallagen
bis etwa 1600m aufwärts. Lokal auch im Alpenvorland, vor allem in den
Flussauen (entlang des Lechs, der Isar zwischen München und Freising und an der Unteren
Alz) sowie zwischen Ammersee und Starnberger See, dort in
lichten Waldbereichen (zumeist ehemals waldweidegenutzt) und auf Moränen-Kalkmagerrasen.
Des weiteren im Donauraum und Fränkischen Jura auf Flussschotter- und
Talflankenheiden, jahrweise in größerer Anzahl. Flugzeit spät, überwiegend
im August. Die Falter saugen sehr gerne an Wasserdost, Tauben-Skabiose,
Dost und Gold-Distel. Ansonsten versammeln sich die Männchen gerne an
feuchten Wegstellen, eine Ansammlung auch an einer toten Erdkröte.
Außerhalb der Alpen deutlich rückläufig, z.B. an der Isar zwischen
Schäftlarn und München, im Perlacher Forst sowie unterhalb von Freising
nicht mehr gefunden.
Aktuelle Nachweise z.B. vom Garchinger Hart (AÖ).
RL D: 3 RL By: V
Einstufung für T/S m.E. unzutreffend, müsste zumindest 3 sein (im
Naturraum Münchener Ebene von den meisten ehemaligen Flugplätzen
verschwunden)
|
Flugzeit: |
29.06. (2007), davor 06.07. (2000) |
- |
15.09. (1995) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
|
- |
1600 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
47 (11/-/-/-/-) |
|||||||||||||||

Graubindiger
Mohrenfalter (Erebia aethiops), Weibchen
Mauern,
Weinberg (ND), 24.07.1999
Erebia medusa (Frühlings-Mohrenfalter)
Regional deutlich rückläufig,
insbesondere infolge der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung
und dem gleichzeitigen Schwinden extensiv genutzter Biotope. Im
Unterbayerischen Hügelland abseits der Donauauen aktuell lediglich an Bahnböschungen bei Reichertshausen
und Paindorf (PAF) gefunden. In weiten Teilen der Schotterplatten, aber auch des Voralpinen Hügel-
und Moorlandes selten geworden, insbesondere generell im östlichen
Oberbayern. Besiedelt ein breites Spektrum höchstens extensiv genutzter
Lebensräume, u.a. Kalkmagerrasen, lichte Waldbereiche und Niedermoore.
Bevorzugt Brachen, fehlt "gründlich" gemähten Biotopen, in
intensiv genutzten Regionen wie z.B. bei Tittmoning (TS) und
Walpertskirchen (ED) reliktär an Bahnböschungen.
Flugzeit überwiegend im Juni. Blütenbesuche u.a. an Hahnenfuß,
Habichtskräutern und Thymian, des öfteren auch an Hundekot.
RL D: V RL By: V (T/S: 3)
Ähnliche Art: Erebia oeme. Unterschiede: E. medusa ist größer;
Fühlerkolbenunterseite bei E. oeme schwarz, bei E. medusa braun; Doppelpunkt
auf der Vorderflügelunterseite bei E. oeme auffallend zusammenliegend und
von nicht soviel Orange umgeben. Überschneidungsmöglichkeit jedoch nur
in den tieferen Lagen des Alpenraumes.
|
Flugzeit: |
25.04. (2007), davor 03.05. (2000) |
- |
06.07. (1991) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
|
- |
900 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
31 (-/39/21/-/24) |
|||||||||||||||

Bahneinschnitt bei Tittmoning (TS), eines der letzten
verbliebenen Vorkommen
des aus weiten Teilen Ostoberbayerns
verschwundenen
Frühlings-Mohrenfalters

Frühlings-Mohrenfalter (Erebia
medusa)
Eching, Mallertshofer Holz (FS), 10.06.1994 (oben und unten)


Mallertshofer Heide
(M-L)
Die Heideflächen und lichten Kiefernwälder bieten etwa 55 Tagfalterarten
Lebensraum. Dementsprechend zählt dieses zu den Landkreisen M-L und FS
zählende Gebiet zu den artenreichsten und wertvollsten in ganz
Oberbayern. Besonders beachtlich ist das Vorkommen des Gelbringfalters.
Des weiteren kommen in individuenreichen Beständen verschiedene
Perlmuttfalter (u.a. Boloria euphrosyne und Boloria selene),
der Frühlings-Mohrenfalter, das Rostbindige Wiesenvögelchen, etliche
Bläulinge (u.a. Himmelblauer und Sonnenröschen-Bläuling) sowie die
Dickkopffalter Spialia sertorius und Pyrgus alveus vor. Das
Gebiet wird vom Heideflächenverein betreut. Teilflächen sowohl im Wald
als auch ausserhalb werden gemäht bzw beweidet.

Lebensraum des Eis-Mohrenfalters (Erebia pluto):
oben Kare auf der Nordseite der Östlichen Karwendelspitze,
1700m (GAP), Juli 1994
unten Geröllfluren unterhalb der Zugspitze, etwa 2000m (GAP), Juli
2002
Fotografieren ließen sich die Tierchen aber höchst ungern bis gar nicht
Erebia pluto (Eis-Mohrenfalter)
Art der subalpinen und alpinen Höhenstufe.
Eigene Beobachtungen zwischen 1600 und 2400m aus dem Wetterstein- und dem
Karwendelgebirge, durchwegs von Geröllfeldern und deren Rändern.
Fundorte: Knorrhütte, Gatterl, Höllental-Angerhütte, Westliche und Östlichen
Karwendelspitze, dort am nordseitig gelegenen Kar (um 1600m). Fehlt in den
Berchtesgadener Alpen. An denselben
Stellen meist auch Erebia gorge. Flugzeit im Juli und August. Blütenbesuche an der Großblütigen
Gemswurz und an Habichtskräutern.
Hat wie die meisten hochalpinen Tagfalterarten eine (zumindest)
zweijährige Larvalentwicklung.
RL D: R RL By: R
|
Flugzeit: |
19.06. (2002) |
- |
13.08. (1998) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
1387 |
- |
2384 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
|
|||||||||||||||
Erebia gorge
In den Hochlagen der bayerischen Alpen im
Bereich vegetationsarmer (teils nordexponierter) Kare und Schuttkegel. Eigene Funde im
Ammer-, Wetterstein- und Karwendelgebirge sowie aus den Berchtesgadener Alpen in Höhenlagen
zumeist zwischen
1700 und 2400m, oft gemeinsam mit Erebia pluto. Im Wimbachgries (BGL) 2005
bereits auf
1300m gefunden. Flugzeit im Juli und August.
Eine gezielte aktuelle Überprufung früherer Vorkommen wäre u.a. an folgenden Orten sehr
wünschenswert: Jägerkamp (8337/1) und Schinderkar (8337/3)
RL D: R RL By: R
|
Flugzeit: |
19.06. (2005) |
- |
30.08. (2005) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
1300 |
- |
2300 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
|
|||||||||||||||

Wimbachgries
(BGL), Juni 2005
Der größte Schuttstrom im oberbayerischen Alpenraum
Lebensraum von Erebia gorge, des weiteren u.a. Coenonympha
gardetta,
Lasiommata petropolitana und Pyrgus andromedae

Erebia gorge
Mittenwald,
Oberes Dammkar, 2200m
(GAP), 09.08.1994

Lebensraum der Mohrenfalter Erebia gorge und Erebia pluto
bei der
Knorrhütte, etwa 2050m (GAP)

Erebia pronoe, Weibchen
Geigelstein, 1700m (RO), 08.08.1998

Erebia pronoe
Karwendeltal (Nordtirol), 25.07.1999

Wolfsschlucht (MB)
Lebensraum des Wasser-Mohrenfalters,
des weiteren u.a. Senf-Weißling,
Früher Perlmuttfalter,
Perlgrasfalter und Kleines Braunauge.

Erebia pronoe, Paarung (oben Weibchen)
Ettal, Ochsensitz, 1500m (GAP), 05.08.2003
Erebia
pronoe (Wasser-Mohrenfalter)
Ausschließlich im Gebirgsbereich. Dort
eine der häufigeren Mohrenfalter-Arten. Von den Tallagen, dort gerne auf
extensiv beweideten Magerrasen, bis oberhalb der Waldgrenze, besonders in
der Krummholzzone im Bereich von Lawinenbahnen, Bächen und Geröllfeldern.
Fliegt Juli / August. Blütenbesuche an Teufelsabbiss, Knautien,
Silberdistel und Großer Sterndolde.
Ähnliche Art: Erebia styx, diese hat einen kleinen Zahn an der braunen
äußeren Randbinde der Vorderflügel-Unterseite und eine fehlende innere
Binde auf der Hinterflügel-Unterseite.
|
Flugzeit: |
06.07. (2000) |
- |
08.09. (2000) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
805 |
- |
2050 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
89 (49/-/-/-/-) |
|||||||||||||||

Erebia styx, Männchen
Berchtesgaden,
Almbachklamm (BGL), 27.08.2005
Foto: Martina Katholnig
Erebia styx
Eine der seltensten Tagfalterarten
Bayerns. Aktuelle Nachweise von der Hasellähne bei Mittenwald (südseitige
Felswände mit viel Aurikel und Stengel-Fingerkraut), vom
Oberen Isartal bei Vorderriß (um 800m, Erstnachweis durch Ulrich Rau) im Bereich südseitiger, stark
aufgelichteter Wälder in Kontakt mit Kalk-Felsfluren (dort in Gesellschaft von
u.a. Gelbringfalter, Schwarzgefleckter Bläuling und Roter
Würfeldickkopf)
und aus dem Berchtesgadener Land (Alfred Haslberger). Am 27.08.2005 in der Almbachklamm bei Berchtesgaden bestätigt. Dort an Kalk-Felsfluren mit u.a.
Stengel-Fingerkraut, Silberwurz, Blauem Steinbrech und Breitblättrigem
Laserkraut.
Blütenbesuche bevorzugt am Stengel-Fingerkraut (Potentilla aurescens).
Die Raupe lebt an Kalk-Blaugras (Sesleria varia).
RL D: R RL By: R
Einstufung m.E. unzutreffend, 1 oder 2 wäre angebracht (geringe Anzahl an
Fundorten, akute Gefährdung der Vorkommen durch Verwaldung der Felsfluren und Aufforstungen)

Erebia styx, Weibchen (oben und unten)
Blütenbesuch an
Stengel-Fingerkraut
Vorderriss (TÖL), 11.08.1995
Fotos: Heinz Ruppert
Erebia styx, Weibchen
Almbachklamm (BGL), 27.08.2005
Foto: Martina Katholnig

Almbachklamm (BGL), August 2005

Obere Isar östlich
von Vorderriss (TÖL)
Am südseitigen Hang im Bereich der Felsfluren und am Hangfuß
kommt der
Mohrenfalter Erebia styx vor.
An weiteren Arten u.a. Gelbringfalter, Idas-Bläuling,
Schwarzgefleckter Bläuling und Roter
Würfeldickkopffalter.

Doppelaugen-Mohrenfalter
Rotwand, etwa 1700m (MB), 19.06.2007

Erebia oeme
Karwendeltal (Nordtirol), 25.07.1999
Erebia oeme
Brunnenkopf (GAP), 02.07.2006
Erebia oeme
(Doppelaugen-Mohrenfalter)
Ausschließlich im Gebirgsbereich. Dort
eine der häufigeren Mohrenfalter-Arten. Von den Tallagen bis oberhalb der
Waldgrenze. Breites Lebensraumspektrum. Abgrenzung und Überschneidung mit
Erebia medusa in den tieferen Lagen unklar! Flugzeit im Juni und Juli. Blütenbesuche
an Alpen-Steinquendel und Bergdistel beobachtet.
|
Flugzeit: |
21.05. (2007), davor 29.05. (1999) |
- |
08.08. (1998) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
725 |
- |
1900 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
68 (21/-/-/-/-) |
|||||||||||||||

Gelbbindiger
Mohrenfalter
Oberammergau, Kofel, etwa 1300m (GAP), 19.06.1998
Erebia
meolans (Gelbbindiger Mohrenfalter)
In Oberbayern offenbar nur sehr
lokal in den Ammergauer Alpen, u.a.
im felsbereich des Kofel oberhalb von Oberammergau.
RL D: V RL By: 3

Gelbbindiger
Mohrenfalter
Oberammergau, Kofel, etwa 1300m (GAP), 19.06.1998

Graubrauner
Mohrenfalter
Westliche Karwendelspitze, 2350m (GAP), 22.07.1994
Erebia
pandrose (Graubrauner Mohrenfalter)
Art der subalpinen und alpinen Höhenstufe.
Eigene Beobachtungen aus dem Wetterstein- und dem Karwendelgebirge, v.a.
oberhalb von 2000m, in Gesellschaft von Erebia pluto, gorge, epiphron und
der Bläulinge orbitulus und glandon. Entwicklungszeit
zweijährig, erscheint unmittelbar nach der Schneeschmelze, Flugzeit Mitte Juni bis Ende Juli. Blütenbesuche
am Stengellosen Leimkraut.
RL D: R RL By: R
|
Flugzeit: |
19.05. (2007), davor 19.06. (2002) |
- |
24.07. (1994) |
|||||||||||||
|
Höhenverbreitung: |
1700 |
- |
2384 |
|||||||||||||
|
Verbreitung: |
|
|||||||||||||||
|
Rang: |
|
|||||||||||||||

Hier fühlt sich Erebia pandrose wohl:
Geröllfluren und alpine Rasen unterhalb der
Alpspitze,
etwa 2000m (GAP), Juni 2002

Erebia pandrose, Blütenbesuch
an Silene acaulis
Ehrwald, Südseite Wettersteingebirge, etwa 1900m (Nordtirol),
19.05.2007
unten die Unterseite